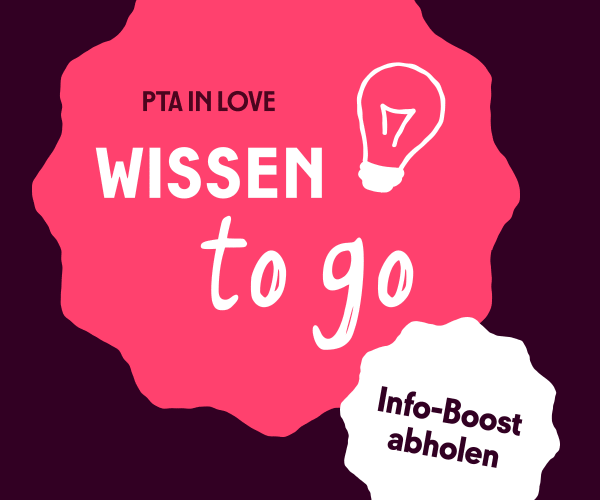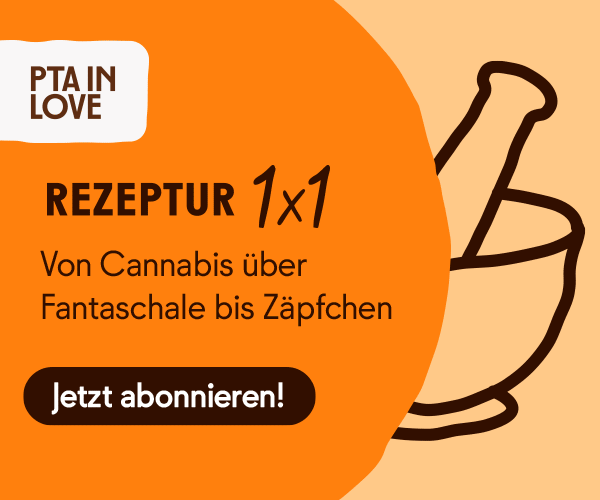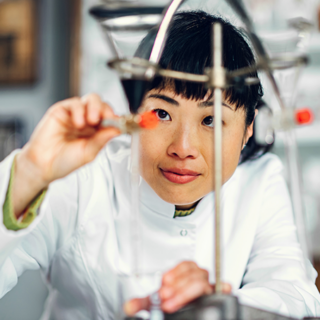Indikationscheck Panikattacke
Bis zu jede/r Vierte entwickelt hierzulande im Laufe des Lebens mindestens einmal eine Angststörung. Angst hat dabei viele Gesichter. Eines davon ist die Panikattacke oder auch Panikstörung. Was du dazu wissen solltest, verraten wir dir.
Auch wenn die meisten Menschen mit dem Gefühl der Angst etwas Negatives verbinden, dient sie als eine Art Rettungsmechanismus, um sich durch Flucht oder Kampf vor Gefahren für Leib und Leben zu schützen. Nimmt die Angst jedoch überhand oder tritt auch ohne drohende Gefahr auf, ist von einer Angststörung die Rede. Dazu zählen neben Phobien auch Panikattacken.
Eine Panikattacke kommt meistens plötzlich und unerwartet und hängt nicht immer von einer bestimmten Situation oder einem speziellen Auslöser ab. Dabei gerät der Körper in eine Art „Extremzustand“. Es wird verstärkt Adrenalin ausgeschüttet, die Gefäße verengen sich und die Muskeln werden darauf vorbereitet, zu arbeiten. Zu den Symptomen einer Panikattacke gehören unter anderem:
- beklemmendes Gefühl,
- Herzklopfen,
- verschwitzte Hände,
- Atemnot,
- Zittern,
- Angst vor Kontrollverlust, Ohnmacht, Herzinfarkt/Schlaganfall oder Tod.
Die Attacke dauert in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde an und verschwindet oftmals genauso plötzlich, wie sie gekommen ist. Bereits nach zehn Minuten ist der Höhepunkt der Angst erreicht. Frauen sind häufiger von Panikattacken betroffen als Männer. Zu den Ursachen für das Auftreten von Panikattacken gehören sowohl genetische Faktoren als auch Stress, psychische Erkrankungen, erhöhter Konsum von stimulierenden Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Drogen. Aber auch bestimmte Medikamente können zu innerer Unruhe und Panikattacken führen.
Übrigens: Tritt die plötzliche Angst häufiger auf, hat sich eine Panikstörung entwickelt. Diese wird begleitet von der „Angst vor der Angst“, also der ständigen Sorge, eine erneute Panikattacke zu erleiden.
Panikattacke: Wie wird behandelt?
Zur Behandlung häufiger auftretender Panikattacken kommen psychotherapeutische Maßnahmen, beispielsweise eine Verhaltenstherapie, sowie eine medikamentöse Behandlung infrage – oftmals auch kombiniert. Benzodiazepine eignen sich zur Behandlung von akuten Angstanfällen, da sie einen schnellen Wirkeintritt erreichen. Nebenwirkungen sind eine eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit sowie ein erhöhtes Risiko für Stürze. Zur Langzeitbehandlung sind sie aufgrund ihres hohen Abhängigkeitspotenzials zudem nicht angezeigt. Hier kommen Antidepressiva, genauer selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie Citalopram und Escitalopram ins Spiel.
Um Patient:innen im Akutfall zu unterstützen, ist unter anderem Ablenkung – zum Beispiel in Form von Bewegung oder Gesprächen – gefragt. Außerdem sollte nicht versucht werden, die Panikattacke zu unterdrücken, sondern sie zu akzeptieren und damit umzugehen. Stellt sich nach mehr als 30 Minuten keine Besserung ein, sollte ein/e Ärzt:in verständigt werden.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Metformin und Alkohol tabu
Metformin gilt als Standard bei der Therapie von Typ-2-Diabetes. Um das Risiko für Nebenwirkungen zu verringern, sollten Tabletten mit dem …
Ibuprofen und Paracetamol: Sicher für Babys
Leiden Kinder unter Schmerzen, stehen im Rahmen der Selbstmedikation verschiedene Arzneimittel zur Auswahl. Doch vor allem bei kleinen Kindern stellt …
Schwangerschaft: Augenschäden durch Arzneimittel?
Dass während der Schwangerschaft bei der Einnahme von Arzneimitteln Vorsicht geboten ist, um eine Exposition des ungeborenen Babys zu vermeiden, …