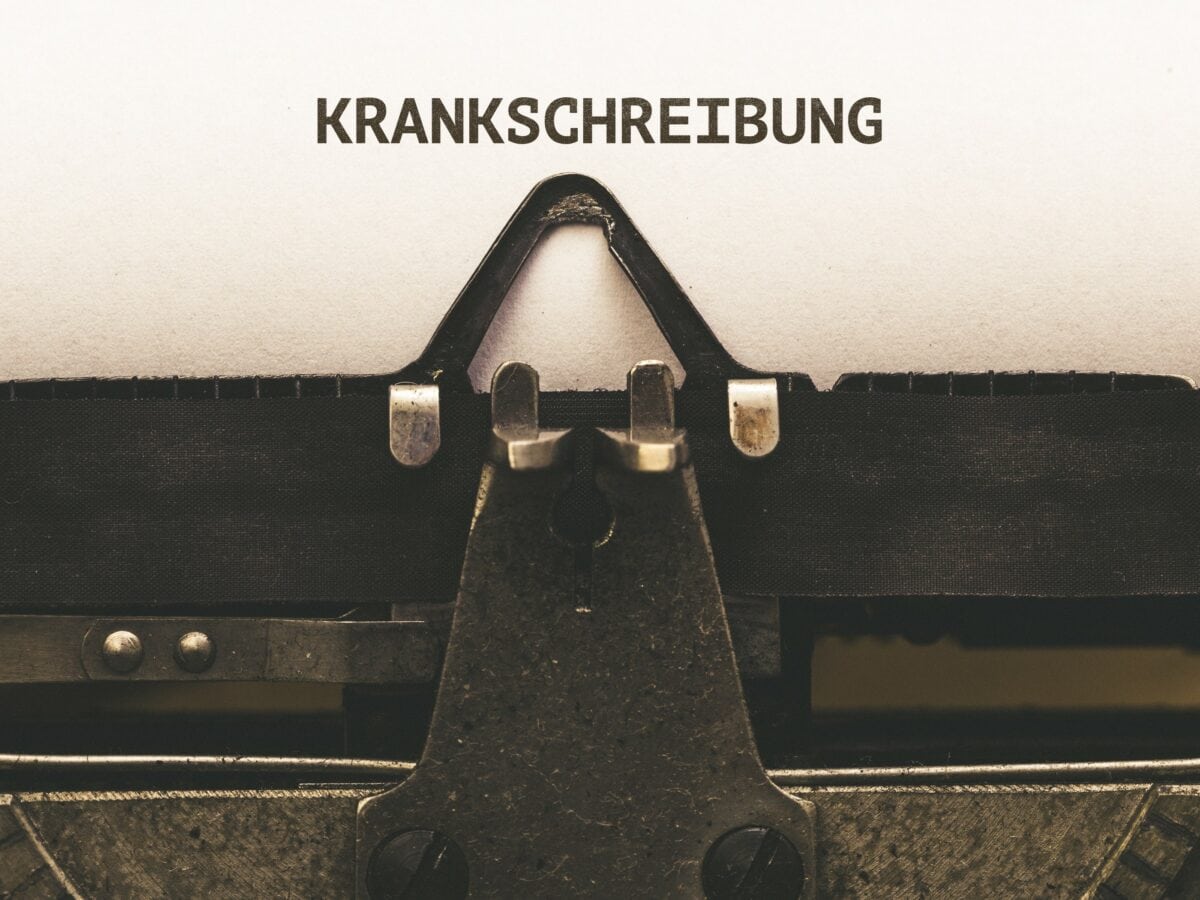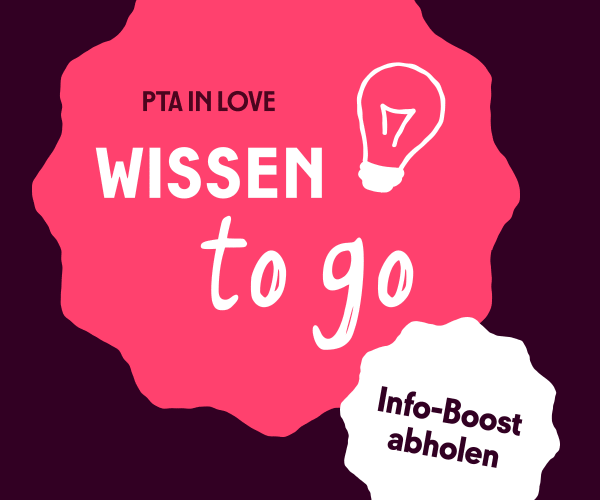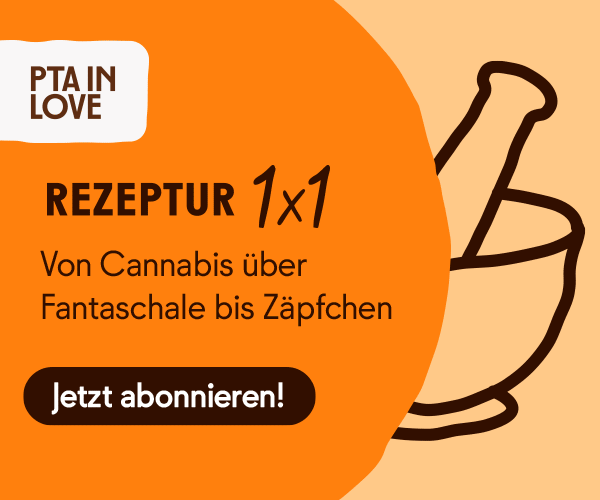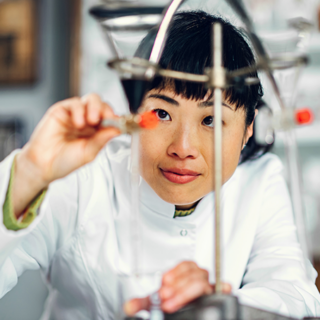Verdienstausfall: Kein Schadensersatz bei Krankschreibung mit falscher Diagnose
Haben Angestellte einen Verdienstausfall, weil sie aufgrund einer objektiv falschen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht arbeiten, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz bei falscher Diagnose. Das hat das Oberlandesgericht Dresden entschieden.
Wer eine Krankschreibung erhält und auf dieser Grundlage nicht arbeitet, muss auf die Diagnose des/der Ärzt:in vertrauen. Dies tat auch ein Angestellter und hatte schließlich das Nachsehen – es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz wegen Verdienstausfall bei Vorliegen einer objektiv falschen Krankschreibung.
Was war passiert? Im Mai 2019 kam es in einer Waschstrasse in Chemnitz zu einem Unfall. Der Betroffene machte Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend – teilweise mit Erfolg. Dann wurde unter anderem darüber gestritten, ob dem Betroffenen ein Schadensersatzanspruch wegen Verdienstausfall über den 5. September 2019 hinaus zusteht. Denn es habe längere Zeit die Gefahr einer Beinamputation bestanden und der Betroffene sei in psychologischer Behandlung gewesen. Für den Zeitraum lag eine Krankschreibung vor. Doch es stellte sich heraus, dass diese falsch war.
Falsche Diagnose = kein Schadensersatz
Der Betroffene habe hingegen auf die Krankschreibung vertraut und sei davon ausgegangen, dass diese medizinisch korrekt sei. Stelle sich im Nachhinein heraus, dass die Diagnose fehlerhaft gewesen sei, so
könne dies nicht zum Nachteil für den Betroffenen sein, führte dieser an. Doch das Gericht urteilte anders.
Erst entschied das Landgericht Chemnitz, dass kein Anspruch auf Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls über den Zeitraum September 2019 hinaus besteht und schließlich auch das Oberlandesgericht Dresden. Dem Betroffenen stehe kein weitergehender Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verdienstausfalls zu. Der Grund: „Auch bei berechtigtem Vertrauen auf die objektiv falsche Krankschreibung liege gegen den Schädiger ein erstattungsfähiger Schadensersatzanspruch des Geschädigten nicht vor. Es genüge nicht, dass der Geschädigte berechtigterweise auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habe vertrauen dürfen. Vielmehr müsse eine tatsächliche objektive Arbeitsunfähigkeit bestehen.“
Zudem machte ein gerichtlicher Sachverständiger deutlich, dass unterschieden werden müsse, ob eine weitere Krankschreibung nach dem 5. September 2019 gerechtfertigt sei oder der Betroffene arbeitsunfähig war. Dem Sachverständigen zufolge war der Betroffene zwar arbeitsunfähig krank, hätte aber durch Behandlung mit Lidocain und Capsaicin-Pflastern ab dem 6. September 2019 wieder arbeitsfähig sein können. Allerdings sei dem Betroffenen die Behandlungsmöglichkeit nicht bekannt gewesen und auch nicht empfohlen worden.
Dennoch: „Für einen Anspruch auf Verdienstausfall über den Zeitraum von zweieinhalb Monaten hinaus bestehe keine Grundlage“, heißt es im Urteil. Der Gerichtssachverständige habe festgestellt, dass eine relevante Schädigung der Nerven von Anfang an nicht vorgelegen habe. Der Betroffene könne sich für seine Behauptung, er sei vom 5. September 2019 bis einschließlich 14. September 2020 wegen seiner neuropathischen Schmerzen arbeitsunfähig gewesen, nicht mit Erfolg auf die Krankschreibungen seines behandelnden Arztes berufen.
Mehr aus dieser Kategorie
Urlaub gebucht, aber (noch) nicht genehmigt: Was gilt?
Während einige Angestellte bereits ihren verdienten Sommerurlaub genießen, müssen sich andere noch gedulden. Doch was gilt, wenn der Urlaub bereits …
Pro Euro brutto bleiben 47 Cent netto
Steuern rauf oder runter? Die Frage ist ein politischer Dauerbrenner, aktuell etwa beim Streit um die Stromsteuer. Ein Verein macht …
APOTHEKELIVE „Apothekenpolitik – Kommt jetzt die Wende?“
Referentenentwurf nach Sommerpause – Politik signalisiert Handlungsbereitschaft Die Apotheken in Deutschland können auf eine Reform hoffen – aber nicht auf schnelle …