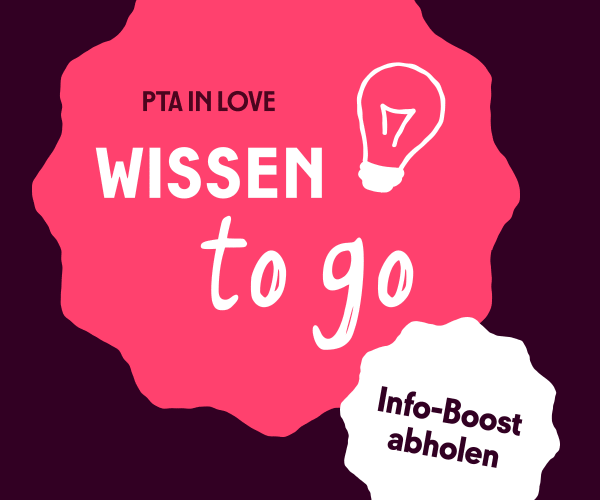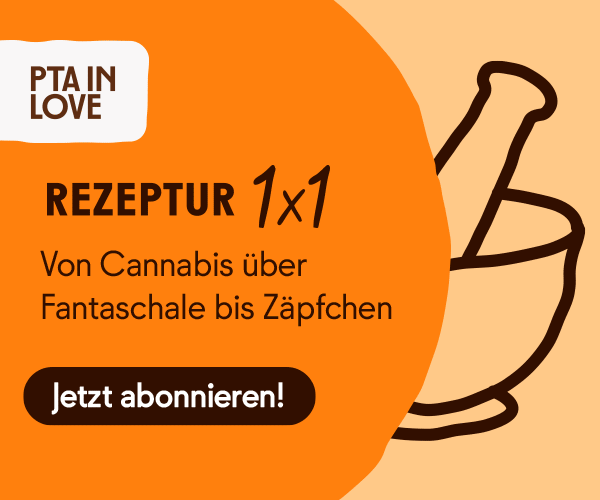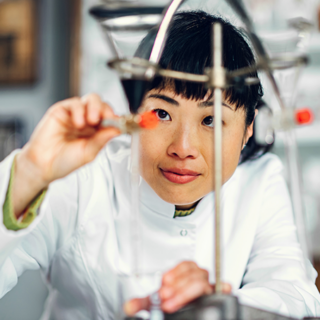Indikationscheck Vibrionen: Infektionsrisiko Sommerbad
Bei sommerlichen Temperaturen sorgt neben Eis essen auch ein kühles Bad für Erfrischung. Beim Sprung ins kühle Nass ist jedoch mitunter Vorsicht geboten. Der Grund: Vibrionen. Was bei einer Infektion zu beachten ist, erfährst du von uns.
Vibrionen sind gram-negative, stäbchenförmige Bakterien, die in Gewässern vorkommen, sowohl in Süß- als auch in Salzwasser. Während Vibrio cholerae O1/O139 als bekanntester Vertreter der Bakterienart Cholera verursachen kann, sind hierzulande vor allem sogenannte Nicht-Cholera-Vibrionen zu finden, die als Bestandteil der normalen Bakterienflora beispielsweise in Nord- und Ostsee vorkommen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert.
Doch ein sommerliches Bad kann gefährlich werden. Der Grund: Steigt die Temperatur im Wasser auf über 20 Grad, vermehren sich die Vibrionen rasant – mit schwerwiegenden Folgen. Denn: Vibrionen können mitunter schwere Infektionen verursachen, darunter Wund- und Ohrinfektionen.
Vibrionen vs. Blaualgen
Auch Blaualgen können hierzulande in verschiedenen Gewässern auftreten. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Bakterienart – genau Cyanobakterien – die Giftstoffe produziert und zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot führen kann. Anders als der Name vermuten lässt, sind Blaualgen nicht blau, sondern als grünliche Schlieren im Wasser zu erkennen.
Vibrionen-Infektion: Das sind die Symptome
Bei Kontakt mit Vibrionen gelangen diese meist durch offene Verletzungen wie Schürfwunden und Co. in den Körper. Die Inkubationszeit liegt je nach Erreger zwischen vier und 96 Stunden. Zu den ersten Beschwerden gehört ein starker Schmerz rund um die Wunde – auch wenn noch keine sichtbaren Anzeichen für eine Wundinfektion vorliegen. Im weiteren Verlauf der Infektion sind Rötungen, Schwellungen und Blasenbildung auf der Haut, Fieber, Schüttelfrost, krampfartige abdominale Schmerzen, Erbrechen und Durchfall häufige Symptome. Bei Risikopatient:innen, beispielsweise bei Diabetes oder einer Lebervorschädigung, besteht zudem das Risiko einer Blutvergiftung. Vibrionen-Infektionen werden hierzulande zwar nur selten diagnostiziert, das RKI geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.
Achtung: Eine Infektion kann auch durch den Verzehr von nicht durchgegarten Fischen, Muscheln oder Krabben, die mit Vibrionen belastet sind, entstehen.
Das zählt bei Beratung in der Apotheke
Daher sollten vor allem im Sommer bei PTA in der Beratung die Alarmglocken schrillen, wenn Patient:innen mit Wundinfektionen und/oder stark schmerzenden Wunden in die Apotheke kommen. In diesem Fall sollte nach den genauen Umständen, vor allem nach einem möglichen Bad in einem Gewässer, gefragt werden. Besteht der Verdacht auf eine Vibrionen-Infektion, ist der Gang Arztpraxis Pflicht, um einen Nachweis per Wundabstrich durchzuführen und frühstmöglich mit der Therapie zu beginnen. Denn die Infektion schreitet schnell voran und kann unbehandelt zu tiefgreifenden Nekrosen und Hautulcerationen führen. Behandelt wird antimikrobiell mit Antibiotika, bei Hautinfektionen gemäß Leitlinie unter anderem mit Cephalosporinen der dritten Generation, Tetrazyklinen oder Gyrasehemmern – allein oder in Kombination. Bei Magen-Darm-Infekten kann auch Ciprofloxacin zum Einsatz kommen.
Übrigens: Akute Vibrionen-Infektionen sind seit 2020 laut Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Liegt nur eine Ohrinfektion vor, muss diese laut RKI lediglich bei einer Ansteckung mit Cholera-Erregern gemeldet werden.
Mehr aus dieser Kategorie
TikTok-Trend Carrotmaxxing: Gefahr für die Herzgesundheit?
„Wer am meisten schluckt, gewinnt“ – unter diesem Motto sorgte Anfang des Jahres die sogenannte Paracetamol-Challenge in den Sozialen Medien …
Grünes Licht für rezeptfreie Aciclovir-Tablette
Am Dienstag tagte der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht. Zwei Wirkstoffe haben eine Empfehlung für einen OTC-Switch erhalten: Aciclovir als Bukkaltablette und …
Polihexanid-Wundprodukte bald verschreibungspflichtig?
Der Referentenentwurf zur 23. Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) sieht Änderungen der Anlage 1 vor. Demnach soll Polihexanid künftig …