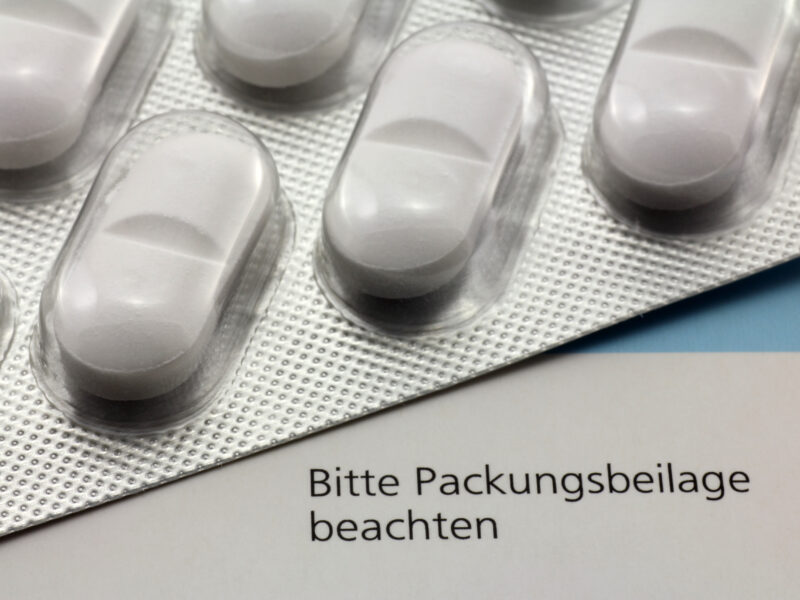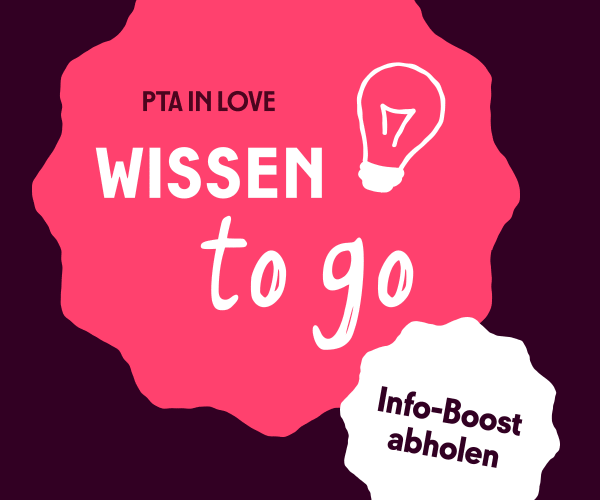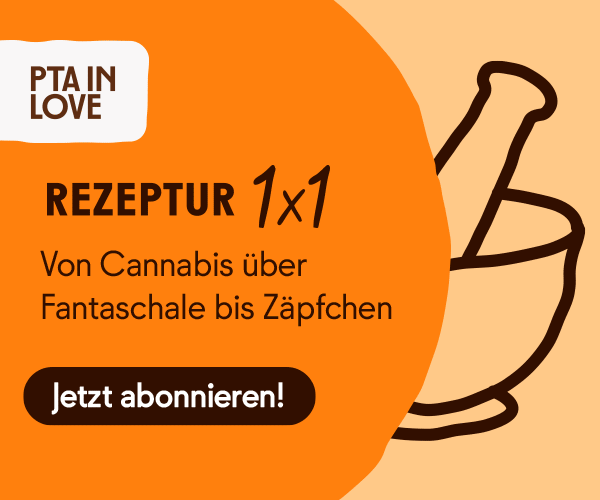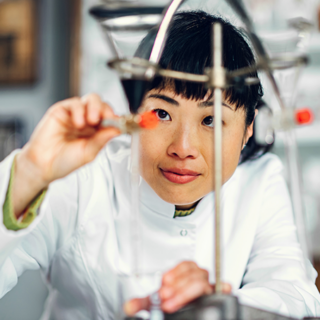Der Magen im Organcheck: „Füllhorn“ mit unverzichtbarer Funktion
„Es geht mir durch den Magen“ – Sätze wie dieser fallen im HV nur allzu oft und Kund:innen suchen deinen Rat. Doch wie kommt es zu Magenbeschwerden? Unser Organcheck frischt dein Wissen zu Aufbau, Funktionen und Erkrankungen des Magens auf.
Der Magen ist schlauch- bis sackförmig und ähnelt dem Aussehen eines Füllhorns oder Angelhakens. Er liegt im linken oberen Bauchbereich unterhalb des Zwerchfells zwischen Milz und Leber. Anders als andere Organe ist der Magen im ursprünglichen Zustand hohl. Erst durch den Verzehr von Speisen und Getränken wird er gefüllt und ist daher besonders dehnbar. Je nach Füllstand, Körperlage und Alter unterscheidet sich seine Größe. Auch das Fassungsvermögen ist individuell verschieden und kann im Schnitt zwischen 1,6 und 2,4 Liter betragen.
Am oberen Ende ist der Magen durch den Magenmund mit der Speiseröhre verbunden, am unteren Ende durch den Magenpförtner mit dem Zwölffingerdarm, dazwischen liegen der Magengrund und der Magenkörper. Im Inneren ist das Organ mit verschiedenen Schichten ausgestattet:
- äußerste Schicht als Deckgewebe (= Bauchfell),
- dicke Muskelschicht, die für die Peristaltik verantwortlich ist,
- Bindegewebsschicht,
- Magenschleimhaut mit Magendrüsen, die Magensaft, wichtige Verdauungsenzyme und neutralen Schleim zum inneren Schutz des Organs absondern.
Magen als Speicher und Transportmedium
Der Magen ist Teil des Verdauungstraktes. Er besitzt den niedrigsten pH-Wert im gesamten menschlichen Organismus und hilft beim Abtöten von Bakterien. Seine Hauptaufgabe ist es, die aufgenommene Nahrung als erste Anlaufstelle auf die Verdauung im Darm vorzubereiten. Gelangt Nahrung durch die Speiseröhre in das Mageninnere, wird sie dort zerkleinert und mit Magensaft durchmischt, wobei ein saures Milieu entsteht, dass Krankheitserreger abtötet. Die durch die Magenschleimhaut abgesonderten Enzyme spalten außerdem Eiweiße aus der Nahrung auf und verdauen diese vor.
Anschließend ist der Magen für den Weitertransport in den Dünndarm verantwortlich. Dieser erfolgt jedoch in kleinen Mengen, weshalb der Magen auch als Zwischenlager für den aufgenommenen Speisebrei fungiert. Dieser verbleibt im Schnitt etwa drei Stunden im Magen. Dadurch ist der Körper ständig mit Nährstoffen versorgt und das Sättigungsgefühl wird aufrechterhalten. Hinzukommt, dass der Magen für die Bildung des sogenannten „Intrinsikfaktors“ verantwortlich ist, der für die Aufnahme von Vitamin B12 benötigt wird.
Funfact: Die Magenmuskeln sind ständig in Bewegung – unabhängig davon, ob gerade Nahrung aufgenommen wurde oder nicht. Dadurch entsteht bei leerem Magen das bekannte „Knurren“.
Magenerkrankungen
Zu den häufigsten Erkrankungen des Magens gehören:
- Magen-Darm-Infektionen: Gelangen Viren oder Bakterien in den Magen und werden nicht abgetötet, können sie eine Infektion verursachen, die sich in Form von Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Bauchschmerzen zeigt.
- Sodbrennen: Das bekannte saure Aufstoßen mit einem brennenden Gefühl entsteht, wenn der Schließmuskel zwischen Magenmund und Speiseröhre nicht ganz schließt, sodass Magensäure die Speiseröhre hochsteigt. Verschiedene Arzneimittel wie Antazida können für Linderung sorgen.
- Magenschleimhautentzündung (Gastritis): Wird der Schutzfilm der Magenschleimhaut beschädigt – beispielsweise durch Krankheitserreger –, kann diese von der Magensäure angegriffen und anverdaut werden. Die Folge sind schmerzhafte Entzündungen, die meist eine Antibiose erfordern.
Achtung: Auch Medikamente wie Antirheumatika können die Magenschleimhaut angreifen. - Magengeschwüre entstehen in der Regel aus einer unbehandelten, chronischen Gastritis.
- Magenkrebs: Wird die Magenschleimhaut ständig gereizt, kann es zu einer Entartung der Zellen kommen, die wiederum zur Tumorbildung führen kann. Weitere Risikofaktoren sind Rauchen, Alkohol, zunehmendes Alter und eine Infektion mit Helicobacter pylori.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Kreislaufschock: Neue Nebenwirkung bei Cotrimoxazol
Cotrimoxazol – die Fixkombi aus Trimethoprim und Sulfamethoxazol – kommt in verschiedenen Indikationen zum Einsatz. Nun müssen die Fach- und …
Vareniclin und Bupropion auch zur Alkoholentwöhnung
Schätzungsweise rund 1,6 Millionen Menschen gelten hierzulande als alkoholabhängig, viele weitere Millionen weisen einen problematischen Alkoholkonsum auf. Forschende wollen nun …
Schadstoffe in Menstruationsprodukten: (K)ein Risiko?
Geht es um Hygieneartikel für die Periode, ist die Auswahl an entsprechenden Produkten groß. Denn neben Tasse und Tampon stehen …