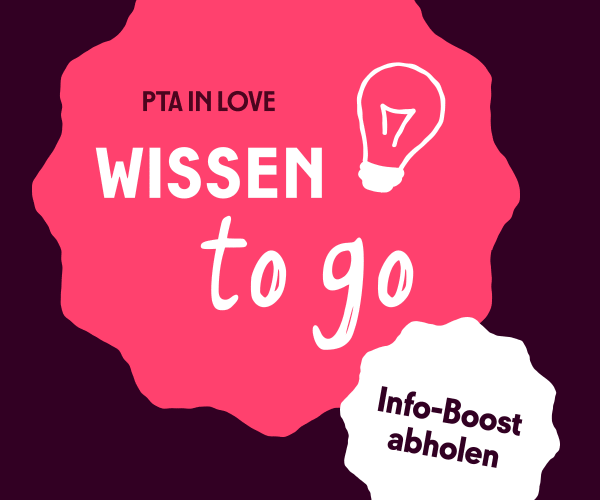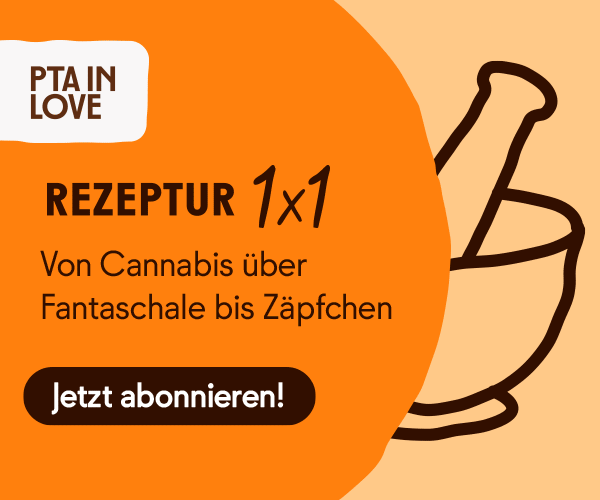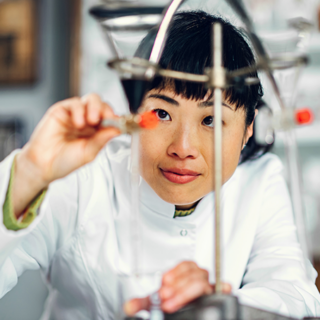Neue Antibiotika aus Austern?
Man liebt oder hasst sie: Die Rede ist von Austern. Denn während einige Menschen gar nicht genug von den Meeresfrüchten bekommen können, ist bei anderen der Ekel vorprogrammiert. Dabei sollen die Tiere zahlreiche positive Eigenschaften auf die Gesundheit haben. Was Austern mit Antibiotika zu tun haben, zeigt eine aktuelle Studie.
Austern werden verschiedene Wirkungen zugesprochen. So gelten sie unter anderem als Aphrodisiakum, auch wenn dies bisher wissenschaftlich nicht belegt werden konnte. Die Meeresfrüchte enthalten außerdem unter anderem Vitamin A, D und E sowie verschiedene B-Vitamine, Magnesium, Kalium, Natrium, Eisen und einen hohen Zinkgehalt. Wie Forschende nun herausgefunden haben, könnten Austern auch bei der Entwicklung neuer Antibiotika eine Rolle spielen. Denn sie enthalten ein Protein, das gegen resistente Bakterien wirksam ist.
Austern als Wirkverstärker
Da Austern zwar kein eigenes Immunsystem mit Antikörperproduktion besitzen, aber dennoch gegen zahlreiche Krankheitserreger resistent sind, wollten Wissenschaftler:innen der Southern Cross University Lismore (Australien) herausfinden, ob sich dies für die Antibiotikaentwicklung nutzen lässt. Dafür haben sie die australische Felsenauster näher untersucht – mit Erfolg. Denn in ihrem Blut wurde eine Substanz entdeckt, mit der sich resistente Bakterienstämme bekämpfen lassen sollen.
Dabei handelt es sich um einen sogenannten Hämolymph-Proteinextrakt (HPE). Dieser besitzt starke antibakterielle Eigenschaften, vor allem gegen den Haupterreger von Lungenentzündungen, Streptococcus pneumoniae. In der Untersuchung wurde das Protein in Konzentrationen von 1–12 μg/ml mit verschiedenen, bereits verfügbaren Antibiotika wie Ampicillin, Gentamicin, Trimethoprim und Ciprofloxacin kombiniert. Das Ergebnis: Es kam zu einer Wirkverstärkung um bis zu mehr als das 30-Fache. Am wirksamsten erwies sich die Kombi gegen die Erreger Staphylococcus aureus (MRSA) und Pseudomonas aeruginosa.
Austern-Proteine als Grundlage für neue Antibiotika?
Den Grund dafür sehen die Forschenden in dem besonderen Wirkmechanismus der Austern-Proteine. Diese können Biofilme und Zellwände durchdringen, sodass Antibiotika leichter zu den Bakterienzellen gelangen und diese bekämpfen können. Gegen menschliche Zellen wirkte HPE dagegen nicht toxisch, sodass die Substanz den Wissenschaftler:innen zufolge als sicher einzustufen ist.
Die Ergebnisse sollen als Grundlage dienen, um aus dem in Austern enthaltenen Proteinextrakt neue Antibiotika entwickeln zu können. Um weiterführende klinische Studien zu ermöglichen, muss jedoch zunächst genügend Wirkstoff über die Züchtung weiterer Austern gewonnen werden.
Mehr aus dieser Kategorie
Neue HRT: Empfehlung für Fylrevy gegen Hitzewallungen
Beinahe jede dritte Frau leidet im Rahmen der Wechseljahre unter starken Beschwerden – allem voran Hitzewallungen. Nun sprechen Expert:innen der …
Atemwegsinfekte: Vitamin D-Mangel erhöht Risiko für Krankenhauseinweisungen
Nicht zu viel, nicht zu wenig. Diess Prinzip gilt unter anderem bei der Versorgung mit Vitamin D. Denn sowohl ein …
Metformin und Alkohol tabu
Metformin gilt als Standard bei der Therapie von Typ-2-Diabetes. Um das Risiko für Nebenwirkungen zu verringern, sollten Tabletten mit dem …