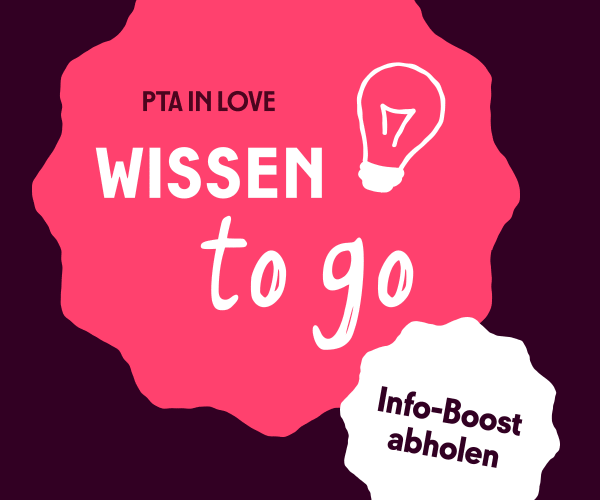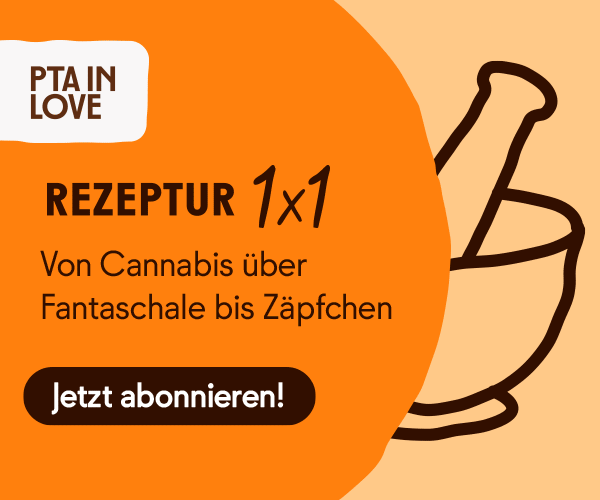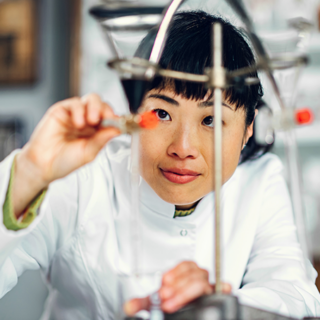70 Prozent: Migränerisiko unter PPI erhöht
Protonenpumpenhemmer (PPI) gehen täglich über den HV-Tisch und werden häufig verordnet. Doch eine Langzeitanwendung ist mit Risiken verbunden. Ob auch ein erhöhtes Migränerisiko unter PPI dazugehört, haben Forschende untersucht.
Protonenpumpemhemmer werden überwiegend zur Behandlung säureassoziierter Erkrankungen eingesetzt. Dazu gehören die Refluxkrankheit sowie Magenschleimhaut- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Außerdem wird die Wirkstoffgruppe prophylaktisch bei einer Einnahme mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) eingesetzt, um säurebedingte Schleimhautläsionen zu verhindern. Darüber hinaus sind PPI in Kombination mit Antibiotika Bestandteil bei der Eradikation von Helicobacter-pylori.
PPI bilden eine Disulfidbrücke mit der H+/K+-ATPase, wodurch diese irreversibel gehemmt wird. Die Entstehung von Salzsäure wird effektiv gehemmt und infolgedessen der pH-Wert im Magen angehoben. In der Folge werden wichtige physiologische Funktionen der Magensäure gehemmt. Dazu gehört die erschwerte Resorption von Eisen, Vitamin B12, Calcium und Magnesium.
Der Magnesiummangel (der sich in Studien im Schnitt erst nach einer Therapiedauer von über fünf Jahren gezeigt hat) kann sich durch Herzrhythmusstörungen und Krampfanfälle bemerkbar machen. Der Mangel an Calcium kann zu Osteoporose führen und damit auch das Frakturrisiko erhöhen. Außerdem wurde der Einsatz von PPI mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht. Jetzt haben Forschende einen möglichen Zusammenhang zwischen Migräne sowie schweren Kopfschmerzen und PPI, Antazida sowie H2-Rezeptorantagonisten untersucht. Das Ergebnis wurde im Fachjournal Neurology Clinical Practice veröffentlicht.
Migränerisiko wegen PPI?
Ausgewertet wurden Daten aus den Jahren 1999 bis 2004 von knapp 12.000 Erwachsenen des National Health and Nutrition Examination Surveys. Die Teilnehmer:innen wurden nach der Anwendung von Säureblockern, dem Auftreten von starken Kopfschmerzen oder Migräne sowie der Supplementation von Magnesium befragt.
Das Ergebnis: Unter PPI und H2-Rezeptorantagonisten klagten 25 Prozent unter Migräne und schweren Kopfschweren, unter Antazida waren es 22 Prozent. In der Vergleichsgruppe ohne Therapie waren es knapp 20 Prozent.
Werden alle anderen Faktoren, die mit einem erhöhten Migränerisiko in Verbindung gebracht werden – Alkohol- und Koffeinkonsum, Alter, Geschlecht – ausgeschlossen, kommen die Forschenden zu dem Ergebnis, dass das Migränerisiko unter PPI 70 Prozent höher ist; bei H2-Rezeptorantagonisten 40 Prozent höher und bei Antazida 30 Prozent höher.
Was könnte der Grund sein?
Unter PPI und H2-Blockern ist ein Magnesiummangel möglich. „Aber der Zusammenhang zwischen Magen-Darm-Beschwerden und Migräne ist wahrscheinlich keine vollständige Erklärung für den in der Studie gefundenen Zusammenhang zwischen säurereduzierenden Medikamenten und Migräne“, so die Forschenden.
Mehr aus dieser Kategorie
Metformin und Alkohol tabu
Metformin gilt als Standard bei der Therapie von Typ-2-Diabetes. Um das Risiko für Nebenwirkungen zu verringern, sollten Tabletten mit dem …
Ibuprofen und Paracetamol: Sicher für Babys
Leiden Kinder unter Schmerzen, stehen im Rahmen der Selbstmedikation verschiedene Arzneimittel zur Auswahl. Doch vor allem bei kleinen Kindern stellt …
Schwangerschaft: Augenschäden durch Arzneimittel?
Dass während der Schwangerschaft bei der Einnahme von Arzneimitteln Vorsicht geboten ist, um eine Exposition des ungeborenen Babys zu vermeiden, …